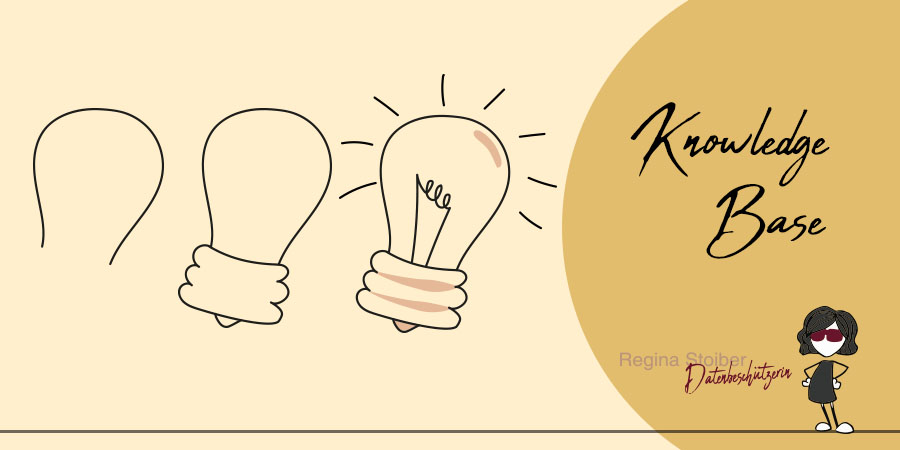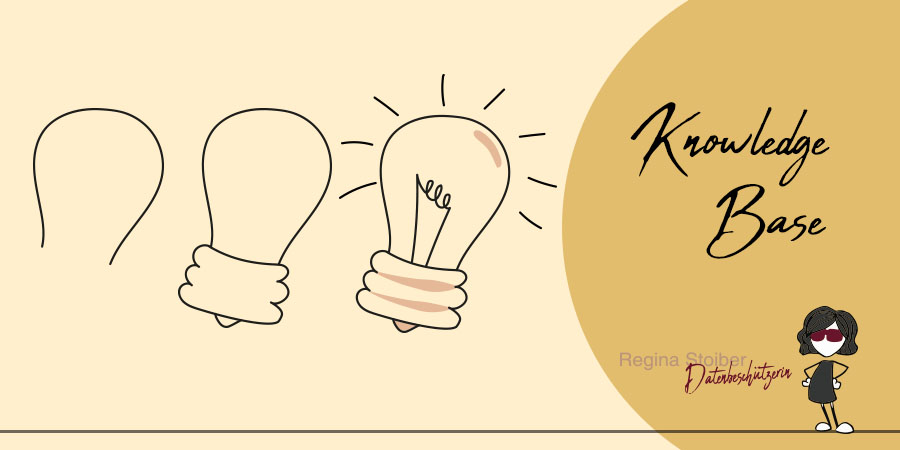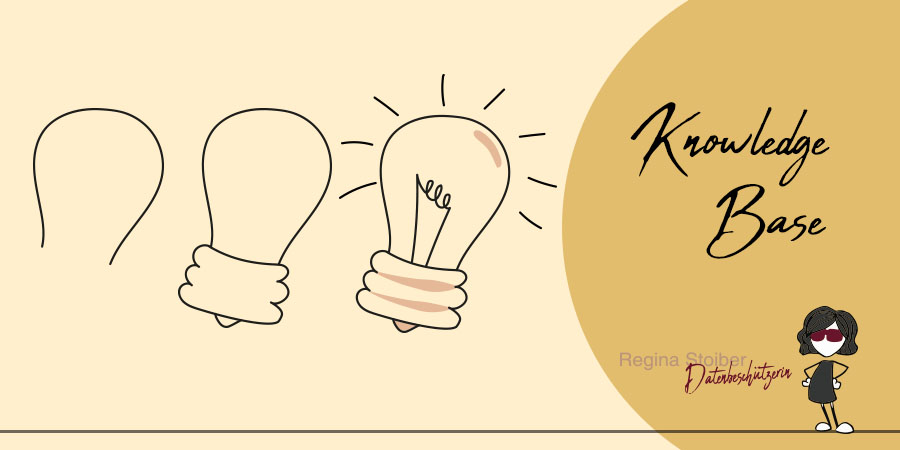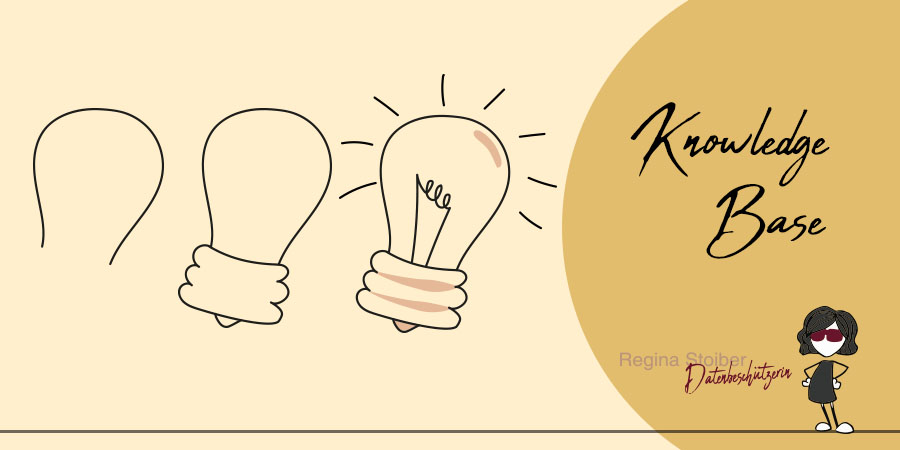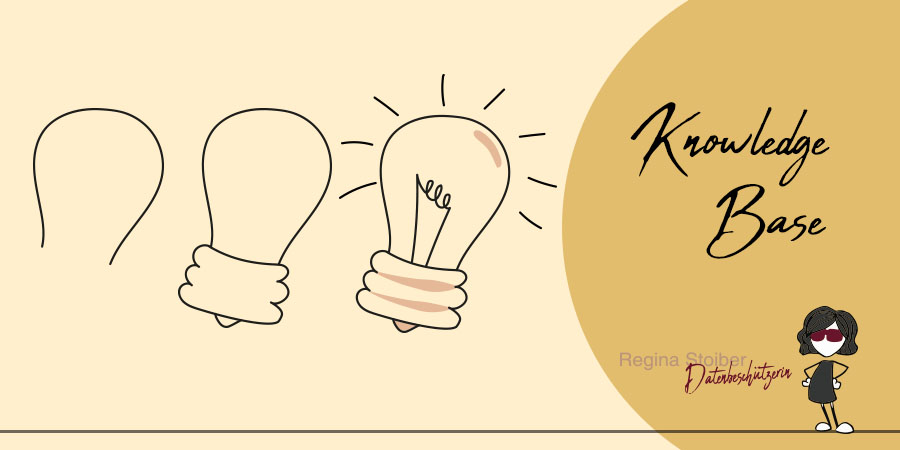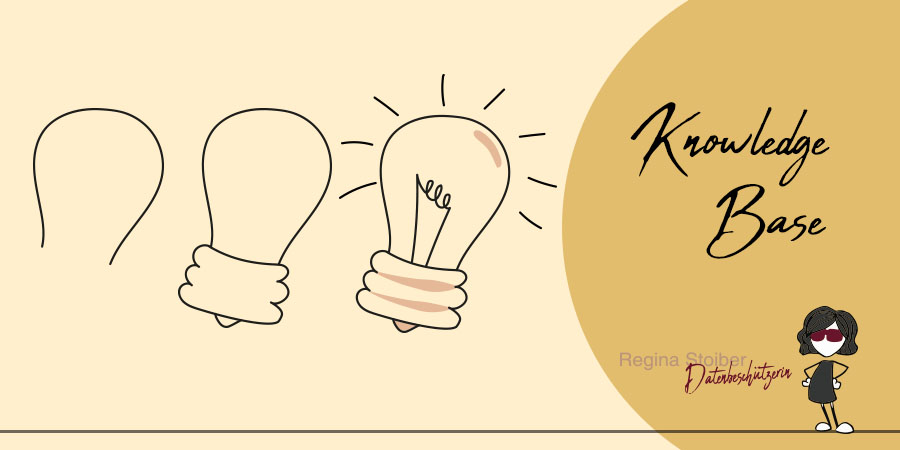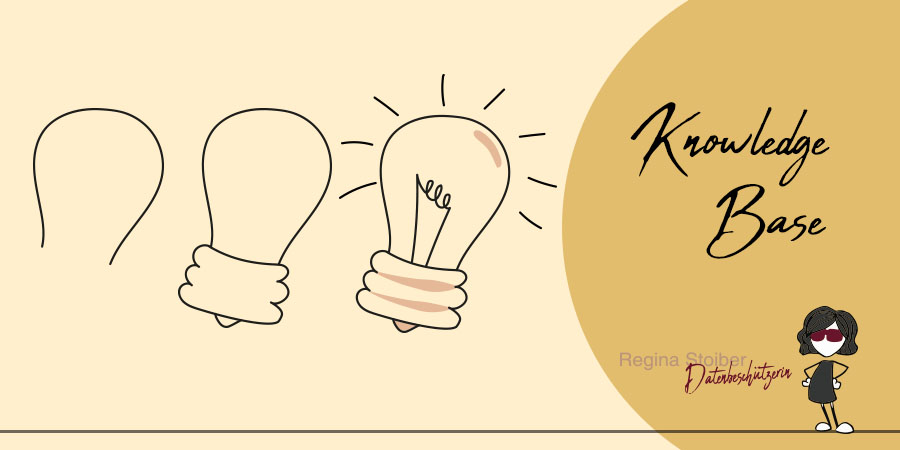
von Jasmin Muhmenthaler-Sturm | Jan 18, 2022 | Datenschutz, DSK-Papier
Die DSK hat Ende Dezember 2021 die Orientierungshilfe für Telemedienanbieter veröffentlicht. Es handelt sich hier um eine Zusammenfassung des relevanten Inhalts durch die Datenbeschützerin. Hinweise oder Anmerkungen seitens der Datenbeschützerin bedeuten, dass diese...
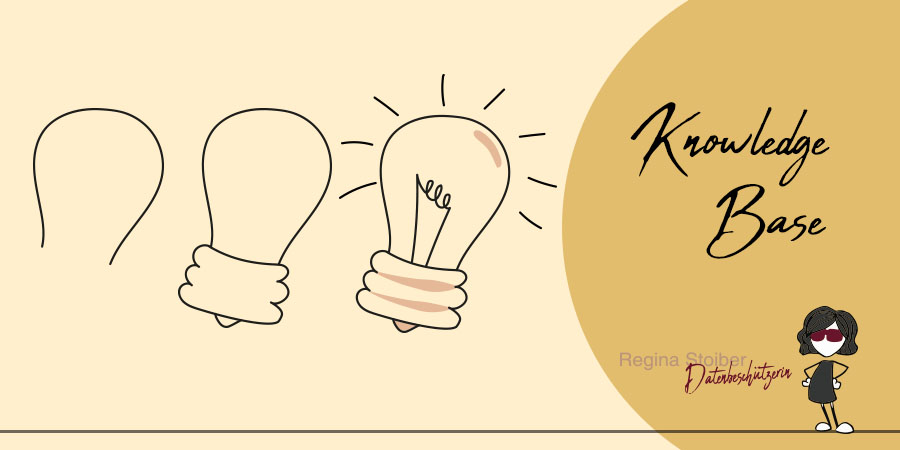
von Jasmin Muhmenthaler-Sturm | Nov 6, 2019 | Datenschutz, DSK-Papier
Seit Inkrafttreten der DSGVO wurden bereits einige Bußgelder in Deutschland und in der EU verhängt. Eine aktuelle Übersicht dazu finden Sie im Artikel zu den Bußgeldern DSGVO. Die DSK hat nun ein Konzept zur Bußgeldberechnung erstellt und veröffentlicht. Mit diesem...

von Jasmin Muhmenthaler-Sturm | Sep 12, 2019 | Datenschutz, DSK-Papier
Darf personalisierte Werbung nach der DSGVO noch versendet werden? Dürfen Kunden telefonisch auf neue Produkte hingewiesen werden? Und vor allem, darf ich jedem Kunden einen Newsletter zusenden? Kochen Sie gerne? Ja, die Frage habe ich jetzt wirklich gestellt. Aber...
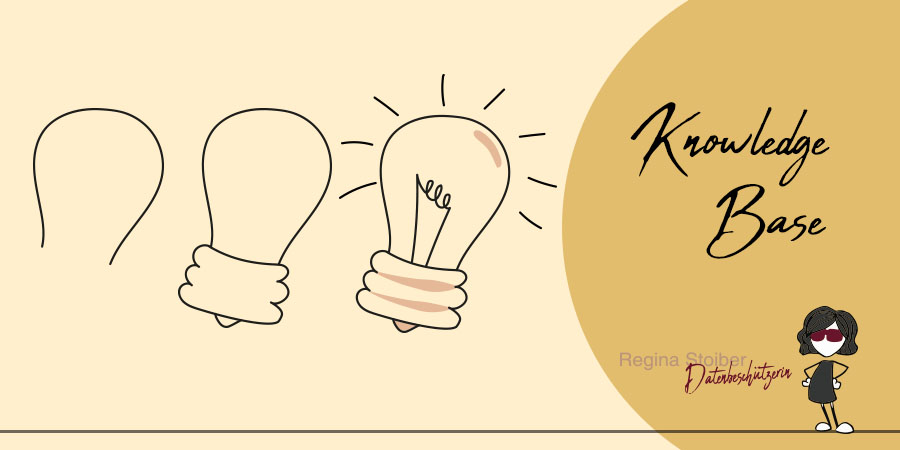
von Jasmin Muhmenthaler-Sturm | Aug 22, 2019 | Datenschutz, DSK-Papier
Auf den Punkt gebracht: Recht auf Löschung Artikel 17 Abs. 1 der DSGVO gibt an, wann Daten durch den Verantwortlichen gelöscht werden müssen.Es bestehen auch Ausnahmen von der Pflicht auf Löschung der Daten. Diese werden in Artikel 17 Abs. 3 DSGVO genannt. Ebenfalls...
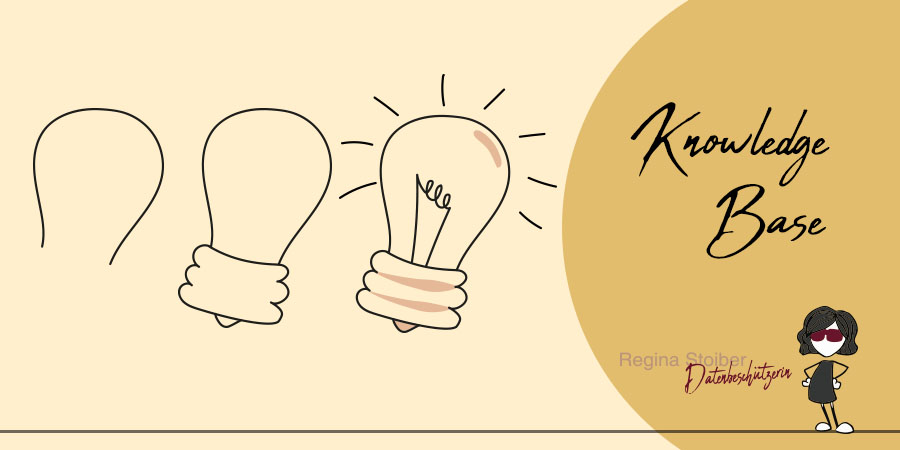
von Jasmin Muhmenthaler-Sturm | Aug 14, 2019 | Datenschutz, DSK-Papier
Auf den Punkt gebracht: Datenübermittlung in Drittländer Als Drittländer gelten alle nicht EU-Staaten. Es wird zwischen sicheren und unsicheren Drittstaaten unterschieden. In sichere Drittländer ist die Datenübermittlung gestattet.Folgende Möglichkeiten erlauben die...
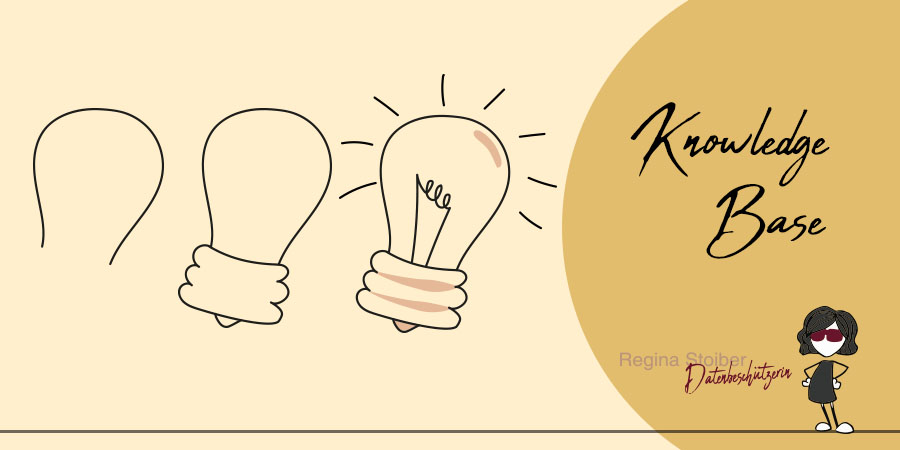
von Jasmin Muhmenthaler-Sturm | Jul 19, 2019 | Datenschutz, DSK-Papier
Auf den Punkt gebracht: Besondere personenbezogene Daten Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind noch höher zu schützen, als „normale“ personenbezogene Daten.Unter die besonderen Daten fallen zum Beispiel: politische Meinung, religiöse...