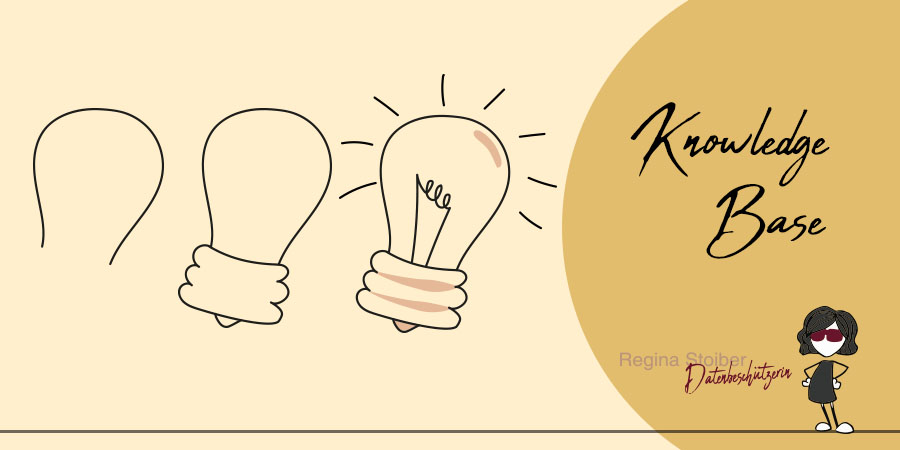von Regina Stoiber | Jun 20, 2020 | Datenschutz, Informationssicherheit, Risikomanagement
Am 16.06.2020 wurde nun die Corona Warn App veröffentlicht. Sie soll uns helfen, die Pandemie weiter im Griff zu behalten und die Infektionsketten schnellstmöglich zu brechen. Wie es bei der Corona Warn App (CWA) mit Datenschutz und Sicherheit aussieht, möchten wir in...

von Regina Stoiber | Jun 10, 2020 | Datenschutz, IT-Sicherheit
Gastbeitrag von Dr. Klaus Meffert Dr. Meffert beschäftigt sich mit dem Thema Datenschutz auf Webseiten. In diesem Gastbeitrag berichtet er, wie Webseiten DSGVO-konform gemacht werden können. Dieser Bericht geht auch auf die häufigsten Probleme in Bezug auf...

von Jasmin Muhmenthaler-Sturm | Jun 3, 2020 | Datenschutz
Vorweg, im Folgenden wird vom Datenschutzbeauftragten in der männlichen Form gesprochen. Der Einfachheit halber beim Lesen unterscheiden wir nicht. Es sind natürlich alle Geschlechter angesprochen. In einem vorherigen Blogbeitrag haben wir bereits die zahlreichen...

von Regina Stoiber | Apr 23, 2020 | Datenschutz, IT-Sicherheit
Videokonferenzen oder Onlinemeetings haben aufgrund der Corona-Krise von einem Tag auf den anderen Einzug in die Unternehmen erhalten. Wer hätte gedacht, dass die Digitalisierung in diesem Bereich nun doch so schnell vonstattengeht? Es ist nicht ganz einfach, aus der...
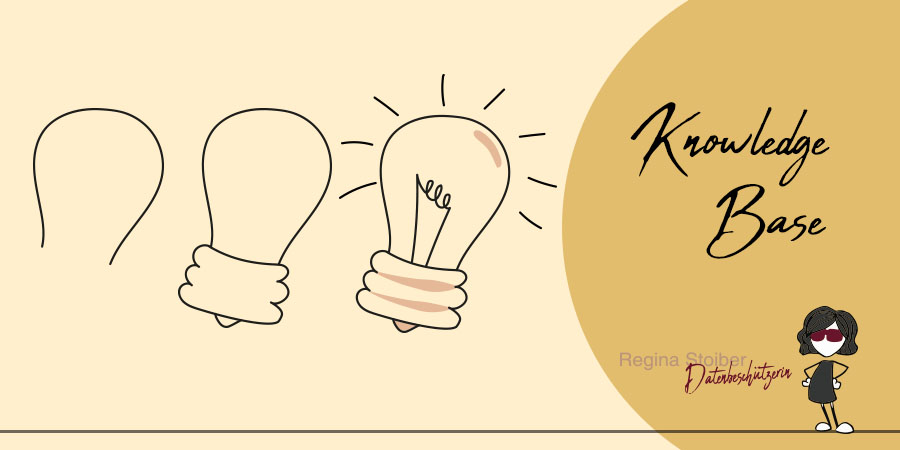
von Regina Stoiber | Mrz 16, 2020 | Datenschutz
In Zeiten des Coronavirus steht an erster Stelle, die Anzahl der Neuinfizierungen über einen längeren Zeitraum zu strecken. Dies führt zu drastischen, noch nie da gewesenen Maßnahmen. Sie als Unternehmen, Behörde, Verein oder sonstige Institution, sind verpflichtet...

von Regina Stoiber | Dez 16, 2019 | Datenschutz
Dieser Artikel basiert auf unserer Erfahrung im täglichen Geschäft mit Kunden, die uns zum Einsatz von WhatsApp im Unternehmen kontaktieren. Der Bericht wurde nicht bezahlt. Der Beitrag kann aber im Einzelfall als Werbung für verschiedene Produkte, die erwähnt werden,...