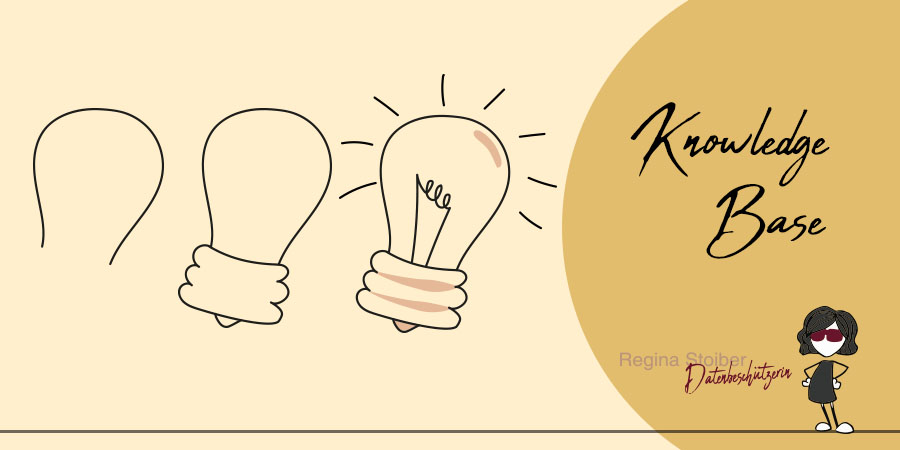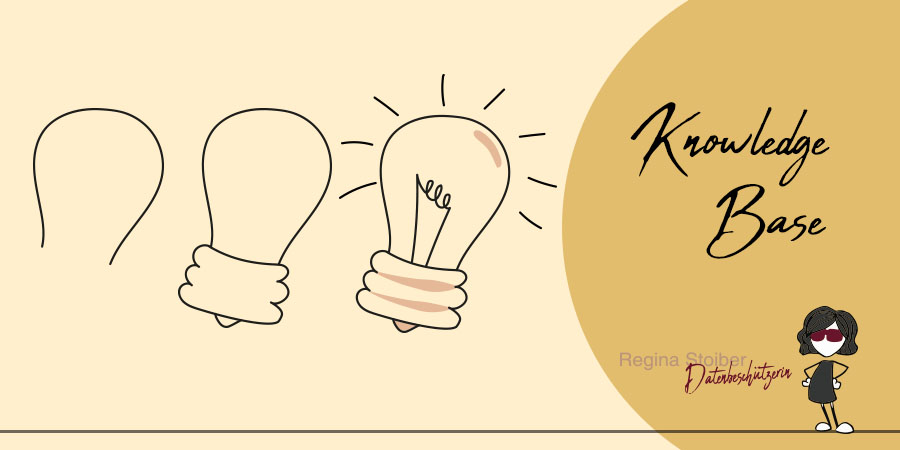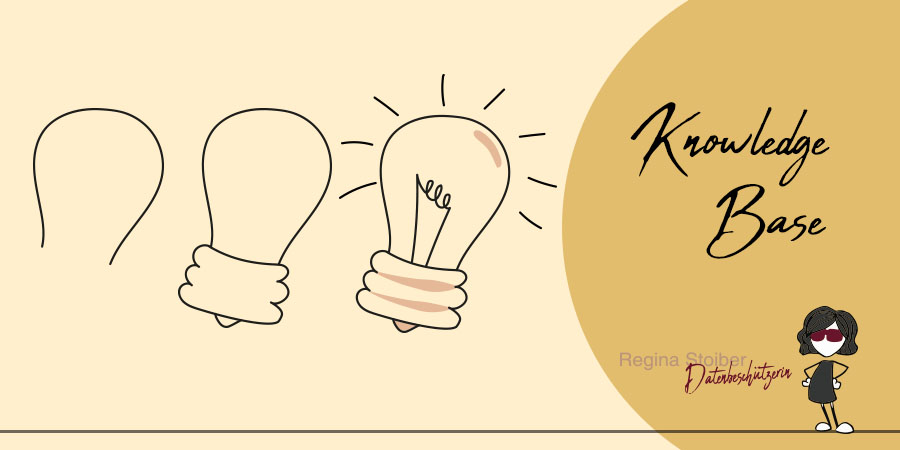
von Jasmin Muhmenthaler-Sturm | Jan 18, 2021 | Allgemein
WhatsApp hat seine AGB und die Datenschutzrichtlinie erst Anfang Januar angepasst. Jeder, der WhatsApp nutzt, erhält derzeit ein Pop-Up und wird um die Zustimmung für die neuen AGB und die Datenschutzrichtlinie gebeten bzw. gezwungen. Doch was bedeuteten die neuen AGB...

von Regina Stoiber | Dez 18, 2020 | Allgemein
Es liegt nah, das Jahr 2020 mit Jammern zu beenden. Was war es auch für ein außergewöhnliches Jahr, das nun hinter uns liegt? Aber ganz ehrlich? Hat den trotz Corona und den daraus ergebenden unschönen Umständen das Jahr nicht aus positive Highlights gehabt? Wir...

von Regina Stoiber | Sep 10, 2020 | Allgemein
Ich bin überzeugt, dass Sie sich schon mal eine der folgenden Fragen gestellt haben: Wie sicher ist die Cloud? Wie sieht es aus mit Datenschutz und Datensicherheit in der Cloud?Welche Risiken gibt es beim Einsatz von Cloud?Darf man im Unternehmen überhaupt Cloud...

von Jasmin Muhmenthaler-Sturm | Jan 6, 2019 | Allgemein
Was erwarten mich für Aufgaben als Datenschutzbeauftragter? Vorweg, im Folgenden wird vom Datenschutzbeauftragten in der männlichen Form gesprochen. Der Einfachheit halber beim Lesen unterscheiden wir nicht. Es sind natürlich alle Geschlechter angesprochen. Die...

von Regina Stoiber | Nov 7, 2018 | Allgemein
Hat Ihr Unternehmen eine IT-Sicherheitsrichtlinie? Haben Sie geregelt, wie Ihre Mitarbeiter mit Informationen, Daten, Passwörtern und anderen Unternehmenswerten umgehen sollten? Wann wird eine IT-Sicherheitsrichtlinie gut angenommen? Was macht den Unterschied bei der...

von Jasmin Muhmenthaler-Sturm | Okt 22, 2018 | Allgemein
Facebook-Gewinnspiele – was Sie als Veranstalter zu beachten haben und woran Sie als Teilnehmer unseriöse Gewinnspiele erkennen Wer kennt sie nicht, die zahlreichen angebotenen Facebook-Gewinnspiele von unterschiedlichen Veranstaltern und...